|
... Vorige Seite
Dienstag, 25. März 2003
Ad "Bushs Law" von Robert Menasse
betablogger
10:12h
„Bushs Law“ von Robert Menasse und warum ich mir anzumaßen wagte, den Artikel als „Dreck“ zu bezeichnen. [Kursive Passagen = Original Menasse] [...] Ich frage mich, ob Menasse sich die französische Geschichte angesehen hat. Die These stimmt ja nur für den inneren Zusammenhalt von Westeuropa – sonst schon nicht. Wie erfolgreich war die „nachnationale“ europäische Politik auf dem Balkan? Wie sieht es aus mit Frankreichs Hegemonialträumen im Nahen Osten – diese sind ja bloß deshalb nicht hegemonial, weil es Frankreich an bestimmtem militärischem Potenzial bzw. geopolitischen Einflüssen fehlt. Wer gesehen hat, wie sich Chirac bei seinem Besuch in Beirut anno 1995 feiern hat lassen bzw. sich die französischen Investitionen im Irak seit 25 Jahren ansieht, der kann nur träumen, es gebe so was wie eine „nachnationale Friedenspolitik“ – es gibt keinen einheitlichen Nenner der europäischen Außenpolitik, was ein Dilemma ist. Aber ein Dilemma sollte man nicht zu einem Pro-Argument machen, nur weil es einem gerade in den Kram passt. Die USA mögen in der technologischen Entwicklung Vorreiter und daher in der Produktion des gesellschaftlichen Reichtums Europa quantitativ voraus sein, in der Frage der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums aber sind sie im Vergleich zu Europa abgeschlagene Nachzügler. Ach ja, die Europäer haben nicht nur die Aufklärung nach Amerika gebracht, sie haben sie auch besser bewahrt als die Amerikaner, weil: Die USA Nachzügler [sind] sogar ihrer eigenen konstitutiven Ideen geworden: Vom Einfluss der Religion auf die Politik bis zur Todesstrafe zeigen sich die USA heute sogar für ihre Sympathisanten als Entwicklungsland der Aufklärung. In Frankreich ist die bürgerliche Revolution gemacht, in Deutschland ist sie gedacht worden. Und wie haben Frankreich und Deutschland eben diese Aufklärung im 20. Jahrhundert verteidigt? Gegen den Einwand der Befreiung vom Faschismus hat Menasse gleich einen Gegenweinwand. Es zeigt sich allerdings auch, dass die Geschichte von der amerikanischen Befreiung vom europäischen Faschismus immer schon nur die halbe Wahrheit war: Die USA ließen den Franco- und den Salazar-Faschismus in Europa ebenso intakt, wie sie hochrangige Nazis schützten, soweit sie ihnen im Kalten Krieg nützlich waren. Im Grunde werden Europa und USA heute durch ihre gemeinsame Geschichte getrennt: Europa, soweit wir lernen und lernen wollen, uns mit dem Kontinent zu identifizieren, hat aus der halben Wahrheit versucht, eine ganze zu machen. Die USA aber haben versucht, aus der halben Wahrheit eine ganze Legitimation für ihre Hegemoniebestrebungen zu zimmern. Das ist selbstgefällig – und ein Schrott, weil in Amerika mehr regiert, als nur ein Sheriff. Ein Blick in die amerikanischen Verfassung hätte Herrn Menasse sicher machen können. Warum wird nicht Europa zum Weltpolizist, der die Aufklärung verteidigt? Menasses Theorie ist zwar nett heglianisch. Sie baut auf die reine Durchsetzung von Ideen; sie lässt die positiven Seiten einer Machttheorie (hier hätte Menasse von Charim und ihrer Foucault-Lektüre profitieren können) vollkommen vergessen; sie blendet hinter der französischen Revolution den terreur aus – sie ist einfach grundpolemisch und sie ist an vielen Punkten historisch vollkommen blind. Hier wird nichts anderes gemacht, als beredt ein Feindbild aufzubauen. Dieser Artikel ist eine einzige intellektuelle Bankrott-Erklärung. Die Gleichsetzung von Bush mit Amerika ist ungefähr so, als würden wir Österreich in toto von den Herrn Schüssel und Haupt repräsentiert sehen. Menasses Artikel ist kaschierter Antiamerikanismus. Ich glaube ja nicht, dass Menasse antiamerikanisch denkt – es ist nur im Augenblick so opportun, sich an eine Stimmungslage anzupassen. Die einen verschleiern halt ihr Ressentiment postmodern (Charim), die anderen postheglianisch. Am Ende bleibt es ein: Ressentiment. ... Link Sonntag, 23. März 2003
Irak-Krieg in Lachsprosa
betablogger
12:10h
Am Wochenende leiste ich mir manchmal wirklich Luxus. Ich kaufe mir eine Schülerzeitung. Hierzulande gibt es sie in Lachsrosa. Das einzig Bemerkenswerte: Die Usual suspects zeigen uns, dass sie noch immer nicht ihrer Studienzeit entwachsen sind, dass sie ihr Halbgedachtes deshalb immer noch in Halbverdautes stecken müssen. Zum Beispiel die "Philosophin" Isolde Charim, mit ihrem Aufsatz "Geburt einer Supermacht" (die neuen Einsichten verrät schon der Titel). Man liest und liest, und am Ende ist alles nur noch Brei: "Es herrscht wohl Konsens darüber, dass [Saddam Hussein] ein schrecklicher Diktator ist. Selbst das Mitgefühl mit der Zivilbevölkerung ist nur ein partielles Argument für die Ablehnung - nicht nur, weil diese auch unter dem Baath-Regime leidet, sondern auch weil dies keine ausreichende Antriebskraft ist. Was die Unbeteiligten [die protestierende Öffentlichkeit] wirklich bewegt, passiert auf symbolischer Ebene - und das war in diesem Fall das Entstehen einer (auch) symbolischen Supermacht. Deren unbedingter Wille nämlich funktioniert jenseits allen Diskutierens - er ist sozusagen der blinde Fleck unseres diskursiven Universums. Insofern ging es in den Debatten der vergangenen Wochen auch längst nicht mehr um den Irak: Die Ablehnung dieses Krieges mutierte zu einer Ablehnung dieses Amerikas. In diesem Zusammenhang steht auch das Phänomen, dass die massiven Reaktionen der Bevölkerungen - oft gegen die eigenen Regierungen, wie etwa in Großbritannien, in Spanien, in Portugal, oder gegen die Medien wie in Berlusconis Italien - zwar erstaunliche Eigenständigkeit bewiesen, jedoch keine demokratischen Energien, keine emanzipatorischen Wirkungen entfalten konnten. Der "gewaltige Schritt vorwärts für die Demokratie", den Bischof Desmond Tutu in diesen Aktionen gesehen haben will (STANDARD, 19. 3.), hat aus einem einfachen Grund nicht stattgefunden: Weil die unheimliche Begegnung mit der Macht alle Diskursivität in eine Ohnmachtserfahrung verwandelte." Früher wurden wir mit Adorno gequält, jetzt verschleiert die Lacan-Foucault Suppe die Abewesenheit zusammenhängender Argumentationen. Man hat nichts zu sagen, als sich an der neuen alten Supermacht abzuarbeiten. Aber der Artikel ist ja noch Gold gegen den Dreck, den Robert Menasse eine Seite weiter serviert. Wenn Europa keine besseren Argumente als solche hat, dann soll es halt weiter zusehen und sich selbstbefriedigen. Man sollte sich halt nur nicht über den zunehmenden Bedeutungsverlust in der Welt wundern. ... Link Freitag, 21. März 2003
Europa und der Irak-Krieg
betablogger
11:57h
Der Wissenschaftshisotiker Wolf Lepenis heute in der SZ. Ein angenhem nüchterer wie vor allem konstruktiver Blick in einer Zeit allseitiger Borniertheit, in der es scheint, als müssten die Gegner des Krieges noch eindimensionaler argumentieren, als dies George W. Bush tut. >> Es ist höchste Zeit, dass die Europäer den Krieg erklären: ihrer Zerrissenheit, ihrem Pessimismus, ihrer Zukunftsangst, dem Dauerbrüten über sich selbst, in dem Jacques Delors die größte Gefahr für unseren alten Kontinent sah. Zum Zeitpunkt des amerikanischen Angriffs gegen den Irak sollte die Stunde Europas schlagen. Was wir gegenwärtig erleben, ist nicht die Teilung Europas, sondern die Teilung des Westens. Europäische Regierungen sind uneins – die europäischen Gesellschaften aber vereint die Ablehnung eines amerikanischen Krieges, der auch gegen das Völkerrecht geführt wird. Zerbrochen ist die AEU – die Amerikanisch-Europäische Union. Sie wird auf absehbare Zeit nicht zu reparieren sein, weil sie bereits nach dem Ende des Kalten Krieges von Vordenkern in Washington aufgekündigt wurde. Der Fall der kommunistischen Regime im Osten läutete auch das Ende des Westens ein. Als die Sowjetunion auseinanderbrach, begannen im Pentagon Planspiele, die den USA „auf unabsehbare Zeit“ die Vorherrschaft in der Welt sichern sollten. Diese Planspiele erforderten einen monströsen Militärhaushalt, sie verlangten die Bereitschaft zum Präventivkrieg, sie zielten auf die Kontrolle „Eurasiens“ und erwähnten internationale Institutionen wie die UNO mit keinem Wort. Nach dem 11. September 2001 wurde aus dem „Plan“, wie er im Kabinettsjargon nur genannt wurde, Wirklichkeit. Richard Holbrooke sprach daraufhin vom Bruch mit einer „bipartisan tradition“, die über ein halbes Jahrhundert lang die amerikanische Außenpolitik bestimmt hatte. Die Europäer haben diese Strategie, die auf den Abschied vom „Westen“ hinauslief, ernst, aber nicht ernst genug genommen. Sie entschlossen sich zur Erweiterung der Europäischen Union – und verhinderten damit die Spaltung Europas, die ein Wunschtraum von Donald Rumsfeld bleiben wird. Sie führten mit dem Euro die Gemeinschaftswährung ein. Um aber wenigstens die ersten Schritte auf dem Weg zu einer gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik zurückzulegen, reichte selbst der Schock des Bürgerkriegs auf dem Balkan nicht aus. Die Irak- Krise hat die innerhalb Europas immer noch bestehenden Spaltungen nicht bewirkt, sondern nur schmerzlich sichtbar gemacht. Aus dieser Krise kann Europa gestärkt hervorgehen – wenn die europäischen Regierungen den Mut zu einer gemeinsamen Politik auf lange Sicht finden. Jedes Land Europas hat nur auf dem alten Kontinent eine Zukunft. Selbst die britische Regierung bekam dies zu spüren, als ihr die USA klarmachten, dass es in der „Koalition der Willigen“ nur einen Willen gibt, den aus Washington. Zu einer europäischen Politik auf lange Sicht gehört auch der Mut, auf das bisher Erreichte stolz zu sein. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden 1776 gegründet. 90 Jahre später zerfleischten sich die Amerikaner in einem blutigen Bürgerkrieg und waren danach noch lange nicht wirklich geeint. Knapp 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs arbeiten die Europäer am Entwurf einer gemeinsamen Verfassung. Ohne die Last der Erinnerung konnten die Amerikaner in der Neuen Welt zur Nation werden. Die vielsprachigen Europäer dagegen mussten sich vom Gewicht unzähliger, mörderischer Geschichten des nationalen Gegeneinander befreien. Dies ist keine kleine Sache – auch wenn die Vereinigten Staaten von Europa gegenwärtig mehr ein Versprechen als eine politische Wirklichkeit sind. Der Enthusiasmus für die Vereinigten Staaten von Europa klingt heute leicht übertrieben. Und dennoch kann aus dem Konflikt mit den USA und aus der innereuropäischen Missstimmung eine wichtige Lektion für die europäische Zukunft erwachsen. Der Weltmachtpolitik der USA muss Europa das Engagement für die Lösung der großen Weltprobleme entgegensetzen. Auf absehbare Zeit werden nur die USA in der Lage sein, eine Weltmachtpolitik zu betreiben. Diese Politik aber nimmt die Vernachlässigung weiter Problemfelder in Kauf. Sie schwächt die internationalen Institutionen, leugnet die Bedrohung durch Umweltkatastrophen und widersetzt sich dem Aufbau einer gerechteren Wirtschaftsordnung. Hier muss eine Weltproblempolitik ansetzen, der sich das ganze Europa mit Engagement und Phantasie widmet. Europa kann dies aus einer Position der Stärke heraus tun: Die gesamte Europäische Union hat 100 Millionen Einwohner mehr als die USA und erwirtschaftet ein um ein Drittel höheres Bruttoinlandsprodukt. Zu dieser Stärke muss die Einsicht hinzukommen, dass die Vernunft der europäischen Politik nicht aus dem Traum des Pazifismus hervorgehen kann. Europa wird sich für die Lösung der Weltprobleme nur engagieren können, wenn es so wehrhaft wird, dass es seine inneren Konflikte ohne die USA regeln und sich im Rahmen der UNO militärisch in der Welt engagieren kann. Die europäischen Nationen haben Jahrhunderte blutiger Kriege hinter sich. Allein im Ersten Weltkrieg verlor Frankreich drei Mal so viele Soldaten, wie Amerika in allen Kriegen, die es bisher führte. Jetzt sind die Vereinigten Staaten von Europa keine Utopie mehr, auch wenn ihre Verwirklichung noch lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Europa hat bereits viel erreicht. Es kann aus der gegenwärtigen Krise lernen und gestärkt hervorgehen. ... Link ... Nächste Seite
| Online for 8566 days
Last update: 16.10.10, 11:54  Youre not logged in ... Login

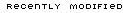
"Twittern war gestern" "Nehmen Sie
Twitter. 2009 gab es hier nicht eine große Fernsehanstalt, die...
by betablogger (22.03.10, 15:05)
Refrigerate your fire When it
feels like you’ve been cancelled Like someone took your breath...
by betablogger (14.03.10, 10:52)
Herr Döpfner und der Zauberberg
Großartig: Die Verkäufer des Tafelsilbers sind die "Gewinner" (in) der...
by betablogger (11.03.10, 10:04)
Online-Video Naked facts about it.
Still, media will keep its eyes wide shut...
by betablogger (10.03.10, 16:11)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||